Die repräsentative Demokratie ist durch etablierte Parteien geprägt und wird durch diese dominiert. Bürgerinnen und Bürger haben immer öfter den Eindruck, dass Dinge im Parlament diskutiert werden, die nichts mit ihrem Leben, mit ihren Lebenssituationen und Erfahrungen zu tun haben. Oder es wird an gesellschaftlichen Mehrheiten vorbei diskutiert und regiert. Wahlmehrheiten spiegeln aber nicht immer gesellschaftliche Positionen in aller Breite wider. Das zeigt sich aktuell nicht zuletzt in Stuttgart oder Gorleben. Eine lebendige Demokratie muss sich weiter entwickeln, auch angesichts der zunehmenden Digitalisierung von Information und Kommunikation.
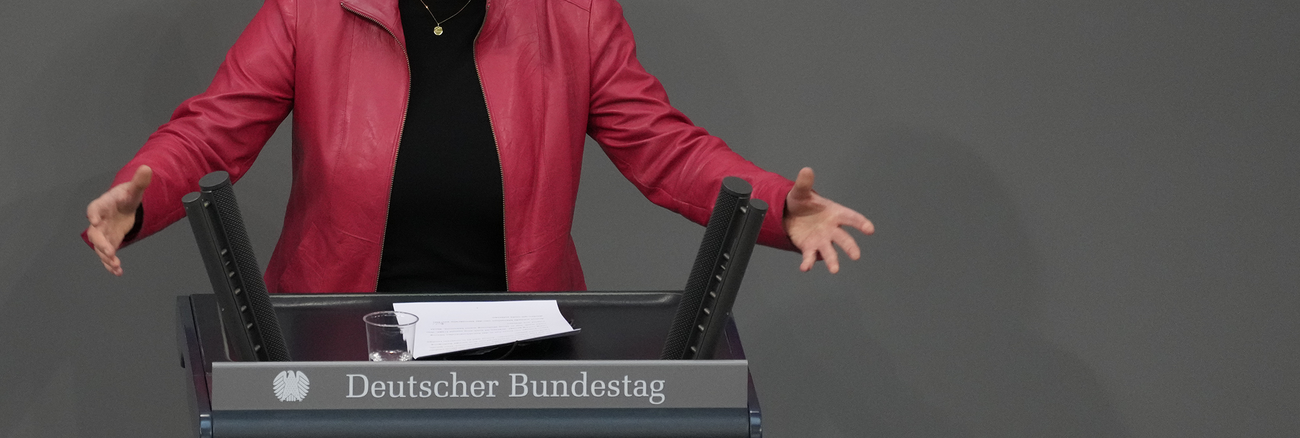
§ 53 StPO dient dem Schutz des Vertrauensverhältnisses. Das meint eine angstfreie Inanspruchnahme von Rat und Hilfe bei bestimmten Berufsgruppen durch diejenigen, die sich an diese Berufsgruppen wenden. Die Norm folgt der Erkenntnis, dass bestimmte Berufsgruppen in einem besonders sensiblen Bereich agieren. Deshalb wäre es logisch, den § 160 a StPO spiegelbildlich zum Zeugnisverweigerungsrecht auszugestalten. Wie soll Ärztinnen und Ärzten gegenüber, Therapeutinnen und Therapeuten gegenüber, Journalistinnen und Journalisten gegenüber Vertrauen aufgebaut werden, wenn die Gefahr besteht, dass Ermittlungsmaßnahmen stattfinden?
Die vornehmliche Frage lautet also: Wie können wir potenzielle Täter, im Regelfall Männer, erreichen und motivieren, keine Übergriffe zu begehen? Es geht darum, zu begreifen, was erwachsene Männer zu Tätern werden lässt und wie wir darauf reagieren können.
Hier kann ein bewusster Blick auf unsere noch immer patriarchal strukturierte Gesellschaft hilfreich sein, eine Gesellschaft, in der immer noch männlich dominierte Rollenbilder existieren und das Aufwachsen der Jungen bestimmen. Auch antiquierte Rollenbilder fördern solche Taten.
Der Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen zur Neuordnung des Rechts der Sicherungsverwahrung und zu begleitenden Regelungen hat einen anderen Inhalt als von der Justizministerin in ihrem Eckpunktepapier im Sommer angekündigt - der Gesetzentwurf ist wesentlich restriktiver. Insbesondere mit dem „Gesetz zur Therapierung und Unterbringung psychisch gestörter Gewalttäter“ wollen CDU/CSU und FDP das Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR), indem der EGMR der Bundesrepublik auf gab, nachträglich Sicherungsverwahrte endlich zu entlassen, aushebeln. Dies ist ein glatter Rechtsbruch und wird verfassungs- und europarechtlich keinen Bestand haben. Zum Thema Resozialisierung steht im Gesetzentwurf gar nichts. Es besteht die Gefahr, dass der im deutschen Strafrecht immer noch geltende Grundsatz der Resozialisierung und Erziehung ersetzt wird durch die Einführung einer sozialen Hygiene. Doch „Wegsperren für immer“ hilft weder den Opfern noch den Tätern.
Die Richtline schreibt Vollharmonisierung vor, um Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt zu begegnen und , da diese Vertragstypen überwiegend grenzüberschreitend relevant sind, Allen den gleichen Schutzstandard zu bieten. Geregelt werden sollen vorvertragliche Informationen, Formerfordernisse beim Abschluss, Widerrufsrechte, die Beendigung etc.
Die Vorgabe der Vollharmonisierung durch die Richtlinie lässt keinen politischen Bewertungsspielraum, sondern lediglich eine Beurteilung im Hinblick auf die handwerklich korrekte Umsetzung zu.
Trotz der Fehler, die dieser Gesetzentwurf aufweist, wird meine Fraktion dem Gesetzentwurf und den Änderungsanträgen zustimmen aus Verantwortung, die wir für die DDR-Geschichte tragen, aber auch, weil 3 000 Anspruchsberechtigte mehr in den Genuss der Opferrente kommen.
Der Gesetzentwurf zur Stärkung des Schutzes von Vertrauensverhältnissen zu Rechtsanwälten im Strafprozessrecht geht in die richtige Richtung - greift aber zu kurz.
Eine rationale Rechtspolitik ist angewiesen auf seriöse empirische Daten. Und es ist Aufgabe des Staates, bevor er zu restriktiven und einschneidenden Maßnahmen greift, in Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten diese zu erheben, auszuwerten und entsprechende Schlussfolgerungen für die Politik daraus zu ziehen.
Abgehobene Politik und zunehmende Berufsmäßigkeit der Interessenvertretung gegenüber der Politik schließen viele Menschen von der Einflussnahme aus. Das zivilgesellschaftliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger wird gestärkt, wenn diese die Möglichkeit haben, direkt über ihre Lebensumstände zu entscheiden. Die Volksgesetzgebung stützt Entscheidungen auf einen gesellschaftlichen Konsens.
Es ist nicht das erste Mal, dass wir im Bundestag über den Schutz von Kindern debattieren. Oft gaben schreckliche Fälle Anlass zur Debatte. Und auch der Antrag der SPD-Fraktion, der heute zur Beratung steht, hat den tragischen Fall des im Jahre 2006 in Bremen zu Tode gekommenen Kevin zum Anlass.