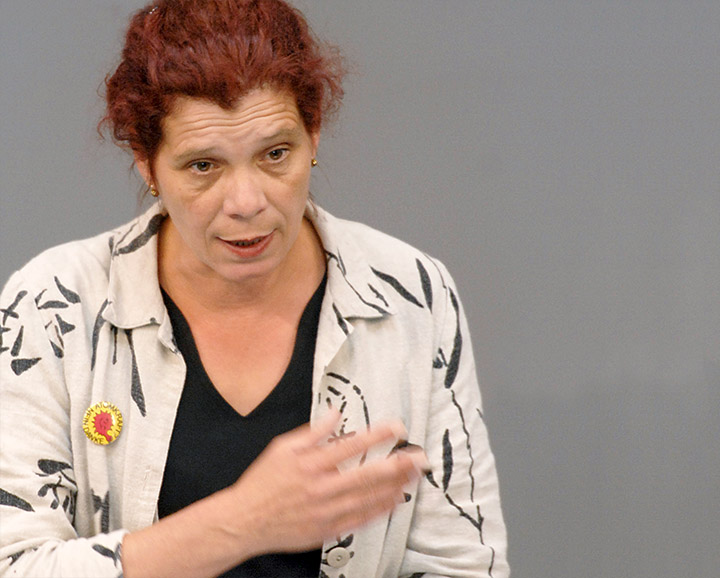Dorothée Menzner (DIE LINKE): Wir behandeln heute ein Thema, das längst in Sack und Tüten sein müsste: die Stärkung der Rechte von Fahrgästen gegenüber Bus- und Bahnunternehmen für den Fall, dass diese nicht so fahren, wie sie sollen: pünktlich, zuverlässig und schnell und vor allem zur geplanten Zeit am Zielort ankommen.
Im Bereich der Fahrgastrechte wird der Bahnkunde zu oft allein gelassen oder bürokratisch abgefertigt. Ziel des Gesetzes ist es, genau dies zu ändern. Die Beförde-rungsbedingungen deutscher Bahnen stammen im Wesentlichen aus den 30er-Jahren und sind von hoheitlichem Staatsgebaren und obrigkeitsstaatlichem Denken geprägt. Sie passen längst nicht mehr in unsere Zeit. Dass es anders und besser geht, machen uns unsere Nachbarländer vor. In Dänemark gilt bereits seit 1934 ein umfassendes Fahrgastrecht. Es ist schon verwunderlich, dass es erst einer Initiative der EU bedurfte, dienstleistungsorientiertes Kundendenken endlich auch im Schienenpersonenverkehr durchzusetzen. Man sollte nicht verschweigen, dass viele Bahnunternehmen gestärkten Fahrgastrechten immer noch reserviert bis ablehnend gegenüberstehen.
Der Vorschlag des Bundesrates sieht vor, schon ab Verspätungen von 30 bzw. 60 Minuten anteilig Reisekosten zu erstatten, eine Forderung, der sich auch die meisten Fahrgast- und Verbraucherverbände angeschlossen haben. Doch die Bundesregierung meint, dass den Kunden erst ab Verspätungen von 60 bis 120 Minuten der Reisepreis anteilig zu erstatten oder dem Fahrgast den Rücktritt von der Reise einzuräumen sei - ganz nach den Wünschen der Bahn. Dass jedoch auch schon 30- oder 60-minütige Verspätungen erhebliche Nachteile mit sich bringen können, muss ich hier nicht extra ausführen. Jeder, der aus einem solchen Grund schon einmal einen Anschluss, einen wichtigen Termin oder Flug verpasst hat, weiß das. So kommt es mir schon befremdlich vor, wenn argumentiert wird, dass den Verkehrsunternehmen bei einer strengen Verspätungsregelung Mehrkosten entstehen. Diese würden sicherlich in die Fahrpreiskalkulation einfließen. Nach den dänischen Erfahrungen machen die Mehrkosten nicht mehr als 1 Prozent aus, also sehr viel weniger als etwa die jüngste Fahrpreiserhöhung der DB AG. Und wenn die Bahnen, allen voran die DB AG, befürchten, dass die Erstattungskosten auf Dauer die Rendite eintrüben könnten, sollte man das einfach zum Anlass nehmen, die Ursachen für die Verspätungen abzustellen.
In den letzten Jahren mehren sich die Klagen darüber, dass Züge dem Fahrplan hinterherhinken, Anschlüsse nicht funktionieren, ganze Züge ausfallen. Die Vernachlässigung des Gleisunterhalts und der Abbau von Ausweichgleisen tragen mit zu den Verspätungen bei, wenn es - jeder Bahnkunde kennt das - zu „Unregelmäßigkeiten im Betriebsablauf“ kommt; Folgeerscheinungen der Renditeorientierung der DB AG für den geplanten Börsengang, der zum Glück derzeit gestoppt ist. Die Konsequenzen dieser Bahnpolitik, bei der die Kundeninteressen immer hinter den Renditen rangieren, hatten bisher immer nur die Reisenden zu tragen. Somit sind Erstattungsentgelte an Reisende für den Fall von Verspätungen, Zugausfällen und verpassten Anschlüssen auch ein Anreiz für die Unternehmen, deren Ursachen zu analysieren und abzustellen. Wenn dem pünktlichen Betriebsablauf bei der Bahn künftig mehr Aufmerksamkeit zuteil wird als der Sicherung eventueller künftiger Aktienkurse, ist das sicherlich im Interesse aller Schienenverkehrsbenutzerinnen und -benutzer im Land. Wichtig ist - das wird in der vorliegenden Begründung zum Geset-zespaket angesprochen -, dass der Reisende über seine Rechte auch ausführlich in-formiert wird. Falsche Auskunft muss ebenfalls, so sie denn Ursache für versäumte Verbindungen und damit Verspätungen ist, ein Grund sein, die Rechte des Reisenden auf Nachteilsausgleich zu begründen.
Wichtig ist der Linken, dass für den Streitfall klare Regelungen dafür getroffen werden, wie der benachteiligte Fahrgast auch nachträglich zu seinem Recht kommt, wenn vor Ort seine Probleme nicht gelöst werden können. Hier haben Schlichtungsstellen, wie sie vom Verkehrsclub Deutschland, VCD, in Nordrhein-Westfalen in vor-bildlicher Weise initiiert wurden, eine große Aufgabe. Die Formulierung im vorliegenden Gesetzeswerk, dass Schlichtungsstellen eingerichtet werden können, reicht mir daher nicht. Und vor allem: Schlichtungsstellen müssen unternehmensunabhängig und neutral sein. Dazu gehören klare Regelungen, wie Schlichtungsstellen einzurichten sind, wie diese personell zu besetzen sind und wie ihre Arbeit finanziert wird.
Natürlich wird die Schlichtungsstelle nicht jeden Streitfall zwischen Kunde und Un-ternehmen gütlich regeln können. In solchen Fällen hat sich das Vorschalten einer vorgerichtlichen Instanz wie Ombudsleuten in der Versicherungswirtschaft bewährt. Diese müssen juristisch gebildet und mit entsprechenden Befugnissen ausgestattet sein, um Streitfälle vorgerichtlich klären zu können. Also auch hier bedarf es fixierter Regelungen. Das sollte uns verbesserter Verbraucherschutz wert sein.
Auch Fachleute bestätigen die Richtigkeit eines solchen Vorgehens. Transparenz und leichte Zugänglichkeit müssen gegeben sein. Es ist gesetzlich zu regeln, wie das zu gewährleisten ist, etwa indem nach britischem Vorbild ein Hinweis auf die Schlichtungsstelle auf jedem Fahrschein abgedruckt ist.
In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf die Bundesratsinitiative hinweisen, ein Fernverkehrsgesetz zu schaffen. Es wäre sehr erfreulich gewesen, wenn ein solches auch ein Teil des Maßnahmepakets wäre, um die Rechte der Fahrgäste zu verbessern.
Die Richtung, die mit der Stärkung der Rechte des Fahrgastes eingeschlagen werden soll, ist richtig, aber am Gesetzesbündel besteht noch großer Klärungsbedarf im Detail. Die Linke will öffentliche Personenverkehre, die sich an den Bedürfnissen der Nutzer ausrichten und nicht dem Zwecke der Gewinnmaximierung der Konzerne dienen. In diesem Sinne werden wir in der folgenden Beratung weitere Vorschläge unterbreiten.
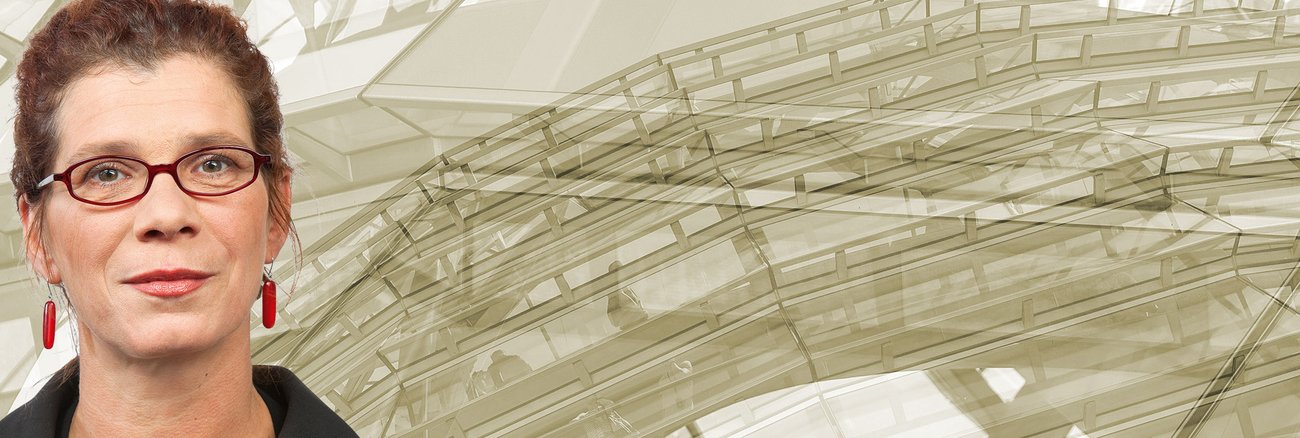
Mehr Fahrgastrechte gegenüber Bus- und Bahnunternehmen
Rede
von
Dorothée Menzner,