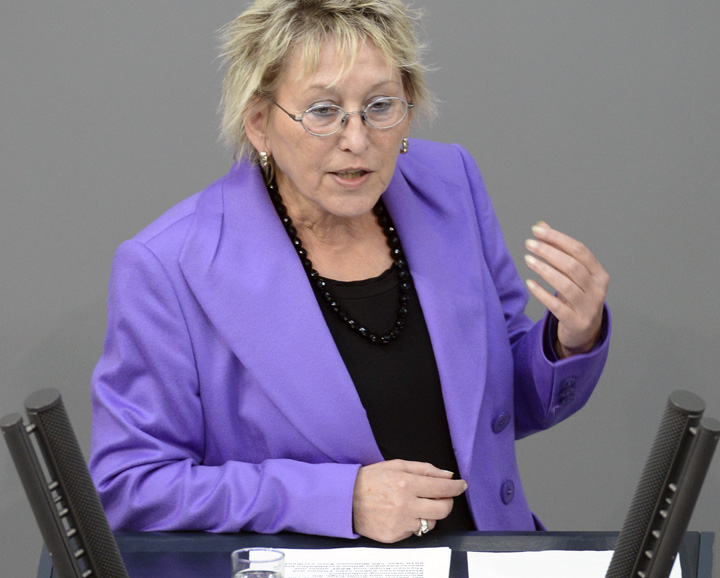Zusatzpunkt - zu Protokoll -
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Hype um Carbon Capture and Storage (CCS) ist mittlerweile unerträglich. Als liege die Lösung unserer Klimaprobleme tief in der Erde. Immer mehr stellt sich jedoch heraus, dass die Abscheidung und unterirdische Speicherung von Kohlendioxid ein Irrweg ist.
Zuletzt musste die Höhe der verfügbaren Speicher deutlich nach unten korrigiert werden. Bis vor kurzem wurde auf Basis von Abschätzungen des Bundesamts für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) davon ausgegangen, dass die verfügbaren Speicherformationen in Deutschland potentiell eine CO2-Menge von 12 bis 28 Gigatonnen (Gt) aufnehmen könnten. Dann wäre Platz für ungefähr 30 bis 60 Jahre Verpressung, geht man von den heutigen Kraftwerksemissionen von rund 390 Millionen t CO2 und der niedrigeren Effizienz der CCS-Kraftwerke aus. Im Mittelwert entspräche diese Zeit ungefähr dem Ausstoß einer Kraftwerksgeneration.
Das Wuppertal-Institut hat in seinem Zwischenbericht zur Studie RECCS plus diese Abschätzung in Frage gestellt. Es rechnet nur mit 6 bis 12 Gigatonnen. Auf eine ähnliche Größenordnung kommt neuerdings auch das BGR selbst in einer aktualisierten Berechnung. Damit reduziert sich die Zeit, in welcher der gesamte heutige Kraftwerkspark seine CO2-Emissionen mittels CCS unter die Erde bringen könnte, ungefähr auf die Hälfte, nämlich auf 15 bis 30 Jahre. Das wäre dann nur noch eine halbe Kraftwerksgeneration.
Berücksichtigt man nun noch, dass aus Wirtschaftlichkeitsgründen für Kraftwerke eigentlich nur Speicher in Frage kommen, die eine größere Kapazität haben als 50 Millionen Tonnen, so sind wir nur noch am unteren Rand, nämlich bei gerade einmal 6 Gt.
Und auch dies ist eine sehr theoretische Zahl, denn die Erkundungen stehen erst am Anfang. Wie viele Räume wegen geologischen Störungen oder Konflikten mit anderen unterirdischen Nutzungen, wie etwa Geothermie, ausgeschlossen werden müssen, ist noch weitgehend unbekannt.
Ferner werden beim Verpressen die bestehenden Formationswässer verdrängt, was natürlich Druck erzeugt und das Fassungsvermögen der Speicher zusätzlich vermindern wird.
Zudem sind in obiger Rechnung die prozessbedingten Emissionen der Industrie (85 Millionen Tonnen) oder die viel diskutierte Speicherung von Biomasse-Emissionen als Option für den Nettoentzug von Treibhausgasen aus der Atmosphäre noch gar nicht berücksichtigt. Sie würden die Speicherzeit noch weiter verkürzen. All dies zeigt: Mit enormem Aufwand wird nun eine Technik entwickelt, die noch nicht einmal eine halbe Kraftwerksgeneration genutzt werden kann, weil dann die Speicher voll wären!
Die Menge des CO2, die jedes Jahr tatsächlich verpresst werden kann, ist zudem technisch begrenzt. Dies wird merkwürdigerweise in der Debatte bislang kaum berücksichtigt. Doch wegen dem höchstmöglichen Verpressungsdruck, der maximalen unterirdischen Ausbreitungsgeschwindigkeit etc. könnten jährlich maximal nur etwa 50 bis 75 Millionen Tonnen gespeichert werden. Diesen Flaschenhals in dieser Größenordnung beschrieb Dr. J. Peter Gerling vom BGR bei der IZ-Klima-Tagung im Januar 2010 in Berlin. Stimmt dies, so würden die Speicher zwar länger reichen. Allerdings würde das CCS-System dann gerade einmal leistungsfähig genug sein, um in jedem Jahr die CO2-Emisisonen der Industrie unter die Erde zu bringen.
Wer es also ernst meint mit der Argumentation, nach der CCS auf jeden Fall für die Industrieemissionen genutzt werden müsse, da diese sich prozessbedingt kaum vermeiden ließen, müsste in Bezug auf Kohlekraftwerke konsequent sein: Für die parallele Verpressung von Emissionen aus Kohlekraftwerken bietet das CCS-Regime schlicht keinen Platz!
Und genau deshalb dürfen auch keine Fördermittel für Demonstrationsvorhaben fließen, die sich mit der CO2-Abscheidung aus Kohlekraftwerken beschäftigen. Da gehen wir mit der Forderung der Grünen mit.
Der Grüne Antrag weist auch auf die Möglichkeit hin, Biomasse-CO2 ab Mitte des Jahrhunderts abzuscheiden und zu verpressen, um der Atmosphäre netto CO2 zu entziehen.
Wir sind da skeptisch. Denn die angedachte Verpressung von Emissionen aus Biomasse-Kraftwerken würde wahrscheinlich energetisch Unfug sein: CCS ist wegen der teuren Abscheidungstechnik und der punktförmigen Verpressung ein im Wesen zentralistisch ausgerichtetes System. Biomasseanlagen dagegen - wenn sie energetisch Sinn machen sollen - sind dezentral ausgerichtet. Nur so lässt sich aus überschaubaren Räumen regional Biomasse beziehen, nur so finden sich Abnehmer für die anfallende Wärme. Setzt man hier CCS ein, so würde aus tausenden Kilometern Ferne Biomasse angekarrt werden müssen. Zudem müsste die Wärme in den meisten Fällen in die Luft geblasen werden. Beides sind unserer Ansicht keine Optionen für eine zukunftsfähige Energiewirtschaft.
Insgesamt sieht die LINKE in CCS keinen Beitrag zur Lösung der Klimaprobleme.
Das Technologieversprechen kommt erst nach 2020 zum Einsatz, also zu spät - wenn es den überhaupt Realität wird. Die Erneuerbaren sind dagegen heute schon verfügbar.
Die Kosten von CCS sind absurd hoch und die Effizienz der Kraftwerke verringert sich.
Außerdem sind die Risiken der Verpressung weitgehend unbekannt. Über den zähen Widerstand der Bevölkerung vor Ort werden sich die Befürworter noch wundern. Gorleben lässt grüßen!
Vor allem aber sind CCS-Kraftwerke nicht mit einem Energiesystem vereinbar, in dem mehr als ein Drittel erneuerbare Energien eingespeist werden. Dies hat der Sachverständigenrat für Umweltfragen mehrmals betont. Gerade die fluktuierende Windkraft erfordert in der Übergangsphase zur Vollversorgung flexible fossile Kraftwerke, wie Gasturbinen, um Berge und Täler bei der Erzeugung auszugleichen. CCS-Kraftwerke sind dafür viel zu träge und würden darüber hinaus unrentabel, wenn sie ständig runtergefahren werden müssten.
Dies eint sie übrigens mit der Atomkraft.
Mittel für die Forschung und für Demonstrationsvorhaben sollten darum vor allem für regenerativen Energien und neue innovative Speicherlösungen ausgegeben werden. Bei CCS eingesetzt sind es von vorherein gestrandete Investitionen.