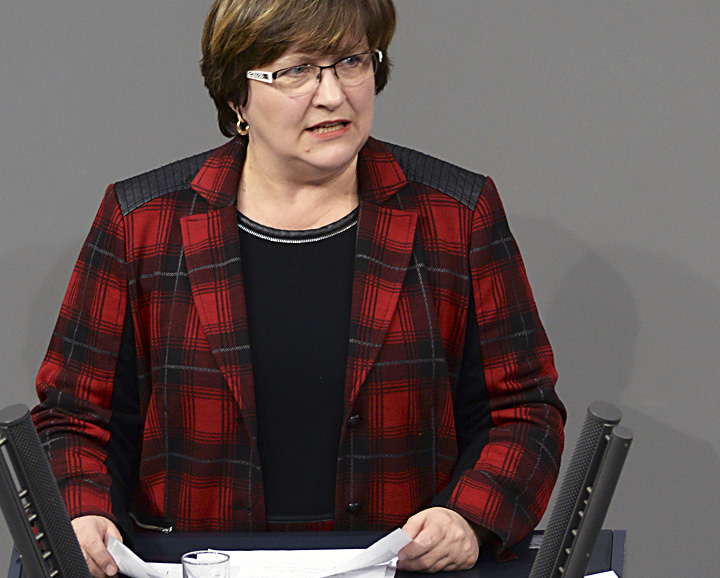Der Lobbyistenverband der Ernährungsindustrie, der BLL, rühmt sich öffentlich damit, die Erstellung des hier vorliegenden Gesetzentwurfes stark beeinflusst zu haben. Bei näherem Hinsehen wird auch klar, warum. Nur zwei der 14 Punkte, die im Laufe des Dioxin-Skandals zwischen der Bundesregierung und den Ländern vereinbart wurden, sollen jetzt gesetzlich geregelt werden. Und das auch nur zu Teilen. Wesentliche Teile des „Aktionsplans Verbraucherschutz“ sollen nämlich am Parlament vorbei per Verordnung durch das Ministerium allein geregelt werden. Lobbyisten, die im Hause Aigner ein und aus gehen, haben damit mehr mitzureden als der Deutsche Bundestag. Das ist nicht hinnehmbar.
Gut an dem Wenigen, dass nur geregelt wird, ist: Private Laboren, die im Auftrag von Unternehmen Schadstoffuntersuchungen durchführen, müssen bedenkliche Mengen künftig direkt an die Behörden melden. DIE LINKE findet es richtig, dass private Labore der Lebensmittelanalyse stärker in die Verantwortung genommen werden. Im Dioxinskandal waren einem solchen Labor die hohen Dioxin-Werte der Verursacherfirma Harles und Jentzsch bereits im März 2010 bekannt. Hätten die Behörden davon gewußt, wäre der Dioxin-Skandal ein dreiviertel Jahr später vermeidbar gewesen. Die Meldung der Daten ist also eine wichtige Information für die Ämter, darf jedoch nicht die einzige sein.
Deshalb auch gut: Die Unternehmen werden verpflichtet, alle durchgeführten Schadstoffmessungen – auch mit unbedenklichem Ergebnis – an die Behörden zu übermitteln. Doch schon dieser Punkt geht der Lebensmittel-Lobby zu weit. Bei der anstehenden Anhörung zum Änderungsgesetz soll erreicht werden, dass die Ämter keine Informationen über die tatsächliche Belastung unserer Lebensmittel erhalten. Ich sage: Lebensmittel sind kein Betriebsgeheimnis. Wer hier etwas verheimlicht, will den Verbraucherinnen und Verbrauchern etwas vormachen. DIE LINKE wird sich deshalb nicht über den Tisch ziehen lassen. Wir wollen echte Verbraucherinformationen.
An diesem Gesetzentwurf wird deutlich, dass Frau Aigner wieder nur Ankündigungsministerin ist. In ihrem Hause bestimmen offenbar Andere die Richtung. DIE LINKE fordert, dass aus dem Dioxinskandal endlich die richtigen Konsequenzen gezogen werden.
Erstens: Die Lebensmittel- und Futtermittelkontrolle muss systematisch zusammen mit den Bundesländern weiterentwickelt werden. Dazu sind die Eigenkontrollen der Futter- und Lebensmittelbetriebe zu verbessern. Betriebliche Zertifizierungssysteme sind entlang der gesamten Erzeugungskette nach strengen gesetzlichen Vorgaben zu regeln und zu überwachen. Sie müssen Erzeugungsformen und betriebswirtschaftliche Risiken erfassen und eine durchgängige Dokumentationspflicht beinhalten. Dazu muss für jede Futtermittel-Charge vor der Verarbeitung ein Test die Unbedenklichkeit belegen. Wichtig ist auch: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Behörden auf Missstände in Betrieben hinweisen, sollen nach dem Vorbild von Großbritannien und den USA als „Hinweisgeber“ gesetzlichen Schutz erhalten.
Auch die staatlichen Kontrollen sind zu stärken: Die behördliche Lebensmittelüberwachung muss die Wirksamkeit betrieblicher Zertifizierungssysteme überwachen sowie Risiken und Lücken in der Branche frühzeitig erkennen und schließen können. Dazu sind sie personell und finanziell abzusichern. Der Bund soll die Zusammenarbeit der Länder besser fördern. Der jeweils beste Standard im Bereich der Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung in einem einzelnen Bundesland ist deutschlandweit zum Maßstab zu machen. Die Koordination auf Bundesebene ersetzt dabei nicht die Verantwortung in den Ländern. Die Behörden müssen im Verdachtsfall ungehinderten Zugang auf alle Betriebsdaten erhalten, die die Erzeugungskette betreffen.
Zweitens: Mängel in der Lebensmittel- und Futtermittelerzeugung müssen systematische behoben werden. Dazu sind eine verpflichtende Positivliste bei Futtermitteln für Roh- und Zuschlagsstoffe auf EU-Ebene einzufordern. Betriebe sollen durchgängig nach Lebensmittelerzeugung und technischer Produktion getrennt sein. Alle tierischen Fette zur industriellen Verarbeitung sind am Herstellungsort durch Einfärbung kenntlich zu machen. Regionale Erzeugerkreisläufe und betriebseigene Erzeugung von Futtermitteln sollen durch ein Förderprogramm des Bundes gezielt gefördert werden. Das verkürzt die Lebensmittelkette, mindert die Eintragsrisiken und erleichtert die Nachvollziehbarkeit der Erzeugungskette.
Drittens: Die Verbraucherinformation muss erheblich verbessert werden. Die Herkunft der Zutaten in den Lebensmitteln sowie die Verarbeitungsbetriebe müssen auch für den Verbraucherinnen und Verbraucher nachvollziehbar sein. Daten der Behörden und Betriebe sind kein Betriebsgeheimnis, sondern eine wichtige Verbraucherinformation. Dazu muss das Verbraucherinformationsgesetz (VIG) verbessert werden: Die zuständigen Behörden sollen von sich aus über Produkte bzw. Erzeugnisse und Hersteller informieren, wenn Anhaltspunkte für eine Gesundheitsgefährdung vorliegen. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen auch gegenüber Unternehmen ein direktes Auskunftsrecht, beispielsweise zur gesamten Herstellungs- und Lieferkette sowie über die Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards, erhalten.
Viertens: Die Bundesregierung muss die Voraussetzungen für eine systemübergreifende Forschung schaffen, in denen die vielfältigen Fachkenntnisse zusammenfließen, und ein Forschungsprogramm aufsetzen.
Fünftens: Die Verfolgung und Ahndung von Lebensmittelkriminalität ist zu verbessern, indem ein Förderprogramm für Fachleute zur Erkennung von Straftaten in der Lebensmittelbranche aufgelegt wird und die Strafnormen im Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch handhabbarer gestaltet werden. Außerdem sollte der Strafrahmen bei Verstößen gegen das Lebensmittel- und Futtermittelrecht angemessen erhöht werden.
Und Sechstens: Für die vom Dioxin-Skandal betroffenen Landwirtschaftsbetriebe, die keine Möglichkeit hatten, sich der Krise zu entziehen, sollen unverzüglich Entschädigungsleistungen zum Beispiel über die landwirtschaftliche Rentenbank ermöglicht werden. Per Gesetz sollte für zukünftige Schadensfälle ein Ausgleichsfonds geschaffen werden, der von der Futtermittel-Industrie über Abgaben aus dem Handel mit Futtermittelchargen finanziert wird.
So sieht ein Aktionsplan für den Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher aus.
Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.